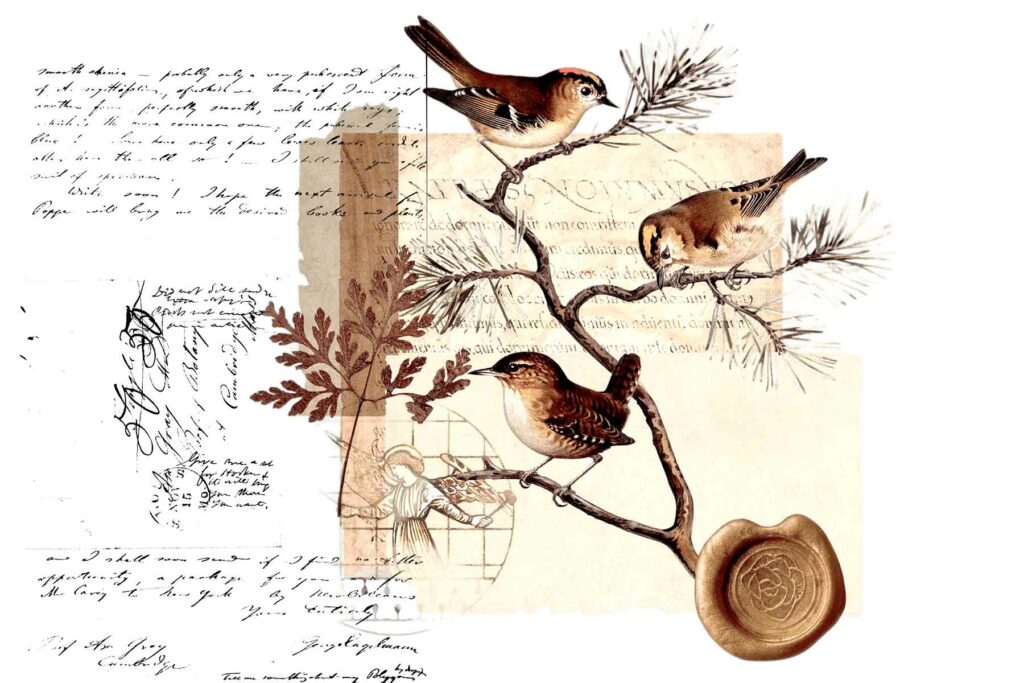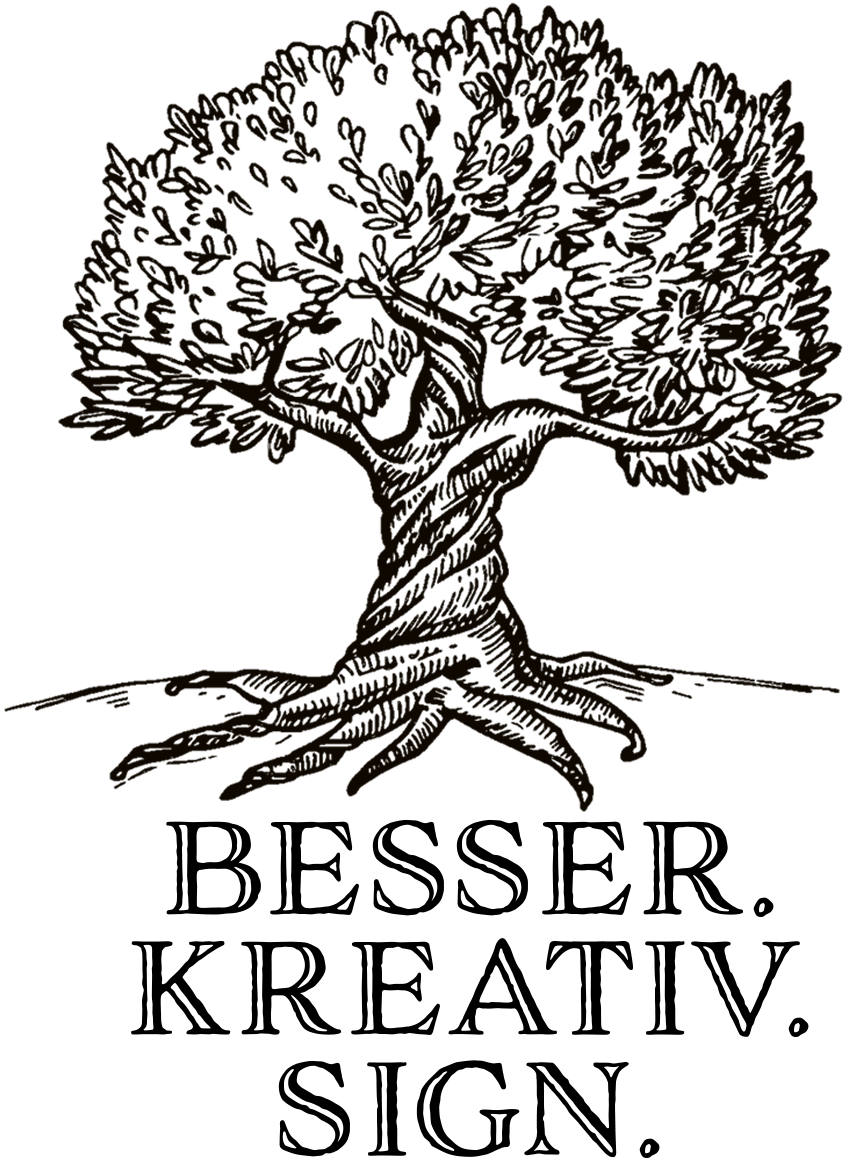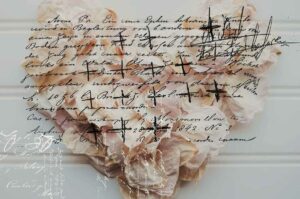Macht Kreativität glücklich?
Was ist das nun mit der »Kreativität«?
Ob Leonardo da Vinci, Shakespeare oder Albert Einstein: Kreative Persönlichkeiten haben die Menschheitsgeschichte geprägt.
Immer wieder haben kreative Köpfe neue Ideen, Objekte oder sogar abstrakte Konzepte erfunden und geschaffen, die unsere Spezies kulturell, technisch oder sozial vorangebracht haben. Nicht nur in der Kunst. Kreativität ist keine rein künstlerische Fähigkeit, sondern auch wichtig für rationale Problemlösung und Innovation.
Aber was genau ist kreatives Denken?
Im Alltag gilt ein Mensch oft als besonders kreativ, wenn er künstlerisch tätig ist, zum Beispiel er kreiert Musik, schafft ein Kunstwerk oder schreibt ein Buch. In der Antike galt diese Form der schöpferischen Tätigkeit sogar als göttlicher Funke oder Inspiration einer höheren Macht.
Mittlerweile ist jedoch klar, dass Kreativität ohne solche übersinnlichen Einflüsse auskommt, sie ist Teil unserer natürlichen Intelligenz. Darüber hinaus ist Kreativität weit mehr als nur künstlerisch: Wer eine innovative Lösung für ein Problem findet, ein neues wissenschaftliches Verfahren entwickelt oder ein neuartiges technisches Bauteil baut, ist auch kreativ.
Eine vergleichende Studie von Kunst- und Naturwissenschaftsstudenten im Jahr 2020 kam zu dem Schluss, dass sich die grundlegenden Merkmale des kreativen Geistes in Kunst und Wissenschaft nicht grundlegend unterscheiden. »Unsere Kreativität ist so universell wie wir denken oder wer wir sind«, so erklärt David Cropley von der University of South Australia. »Jeder, der in Kunst, Mathematik oder Technologie kreativ ist, hat im Allgemeinen eine Offenheit für neue Ideen, die Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen, und Flexibilität im Denken.«
Kreative Verbindung…
Aber was bedeutet das wirklich? Nach aktueller Definition besteht kreatives Denken aus zwei neuropsychologischen Hauptkomponenten: dem konvergenten und dem divergenten Denken.
Konvergente Kreativität kommt zum Einsatz, wenn wir besonders gut darin sind, Zusammenhänge zu erkennen und Assoziationen herzustellen. So können wir basierend auf unserem Vorwissen oder mehreren unterschiedlichen Daten die passende Lösung erstellen.
Wenn Sie gut im konvergenten Denken sind, fällt es Ihnen leicht, viele Synonyme für einen Begriff oder Beispiele für mehrere Kategorien zu finden. Ein weiterer Klassiker unter den konvergenten Kreativitätstests ist der sogenannte Remote Associates Test (RAT). Darin werden Ihnen drei scheinbar völlig unzusammenhängende Begriffe gegeben und Sie müssen ein Wort finden, das mit allen dreien Sinn macht. So lassen sich beispielsweise ›Shampoo‹, ›Fisch‹ und ›Flechte‹ maßgeblich mit dem Wort »Schuppen« assoziieren, die Wörter ›Regenschirm‹, ›Stuhl‹ und ›Blume‹ mit dem Wort ›Sonne‹.
Das Denken »Out of the Box«
Eine andere Art von Kreativität erfordert dagegen das Denken „»Outside the box«, über gewohnte Assoziationen und Perspektiven hinaus. Das passiert zum Beispiel, wenn wir gemeinsam über viele verschiedene Lösungsansätze für ein Problem nachdenken oder wenn wir für etwas Bekanntes ganz neue Anwendungsmöglichkeiten entdecken. Ein klassischer Test für divergentes Denken besteht darin, möglichst viele Verwendungen für einen Alltagsgegenstand zu finden. Eine Büroklammer kann beispielsweise nicht nur zum Zusammenhalten von Blättern oder Fotos verwendet werden, sondern auch zum Verschließen von Taschen, zum Anbringen eines Gummibands am Hosenbund oder sogar zum Aufbrechen von Schlössern.
Warum ein Geistesblitz glücklich macht – Die Wurzeln der Kreativität
Kreatives Denken ist kein neuzeitliches Phänomen: Schon vor Zehntausenden von Jahren zeigten unsere frühen Vorfahren ihre Kreativität, indem sie immer bessere Steinwerkzeuge erfanden, neue Kleidungs- und Lebensformen entwickelten oder beeindruckende Kunstwerke auf hohen Mauern hinterließen. Tatsächlich wird Kreativität als eine Eigenschaft angesehen, die Menschen von ihren tierischen Gegenstücken unterscheiden kann.
Unsere kreativen Gene
Im Vergleich zu anderen Hominiden zeigt der Mensch eine bemerkenswerte Kreativität: Jeden Tag demonstrieren wir Innovation, Flexibilität, Zukunftsplanung und haben auch die kognitiven Voraussetzungen für Symbolik und Selbstbewusstsein. Im Jahr 2021 zeigten ein Intelligenzforscher und Kollegen, dass sich die menschliche Kreativität messbar von frühen menschlichen Formen wie Neandertalern oder Schimpansen, unseren nächsten Verwandten im Tierreich, unterscheidet. Es zeigt sich nicht nur im Verhalten oder in archäologischen Funden, es zeigt sich sogar in unseren Genen. Denn nur wir Menschen haben alle 972 Gene, die mit Kreativität in Verbindung gebracht werden, wie die Forscher herausfanden. Sie ermöglichen uns, Probleme rational und selbstreflexiv zu lösen, aber auch emotional und sozial kreativ zu sein.
Obwohl Schimpansen ebenfalls über 509 dieser Kreativitätsgene verfügen, kontrollieren sie hauptsächlich die Gehirnnetzwerke, die ihnen emotionale und soziale Kreativität verleihen.
„Heureka“- Der Moment, der glücklich macht.
Die Suche nach den biologischen Wurzeln der Kreativität offenbart auch, wie tief diese Fähigkeit in unserem Denken und Fühlen verankert ist. Denn nicht umsonst löst der Moment, in dem wir eine innovative Lösung für ein Problem finden oder uns etwas ganz Neues einfallen lässt, ein starkes Glücksgefühl und tiefe Zufriedenheit aus. Dies gilt insbesondere für das »Heureka«-Erlebnis, bei dem plötzlich alle Puzzleteile und Herangehensweisen zusammenkommen und die Lösung wie aus dem Nichts direkt vor uns liegt.
Yongtaek Oh von der Drexel University in Philadelphia erklärte dazu: »Dieses Gefühl eines »Heureka«-Erlebnis trennt dieses Verständnis des Moments von allen anderen Denkformen. Dies könnte erklären, warum manche Menschen motiviert genug sind, Karrieren in Kunst, Technologie, Design oder Forschung zu verfolgen, Bereiche, die hartes Lernen und herausfordernde Problemlösungen beinhalten.«
Gleichzeitig steckt wohl auch Anstrengung hinter diesem Aha-Moment. wenn wir uns in unserer Freizeit an Kreuzworträtseln, Gehirntraining oder Kriminalgeschichten erfreuen.
Was steckt hinter dem Wohlgefühl, wenn man eine neue Idee, einen Geistesblitz oder eine kreative Problemlösung hat? Oh und seine Kollegen untersuchten dies, indem sie die Gehirnströme von Probanden analysierten, während sie eine komplexe Anagramm-Problemlösungsaufgabe lösten. (Ein Anagramm ist ein Wort oder ein Satz, der durch Neuanordnung der Buchstaben eines anderen Wortes oder Satzes gebildet wird, wobei normalerweise alle ursprünglichen Buchstaben genau einmal verwendet werden.)
In dem von dir beschriebenen Fall wurde den Teilnehmenden ein Kunstwort vorgelegt, das sie zu einem bestehenden Begriff neu anordnen konnten. Diese Art von Aktivität wird oft als kognitive Übung oder als Spiel eingesetzt, um die Fähigkeit, Muster zu erkennen und Probleme zu lösen, herauszufordern und zu verbessern.