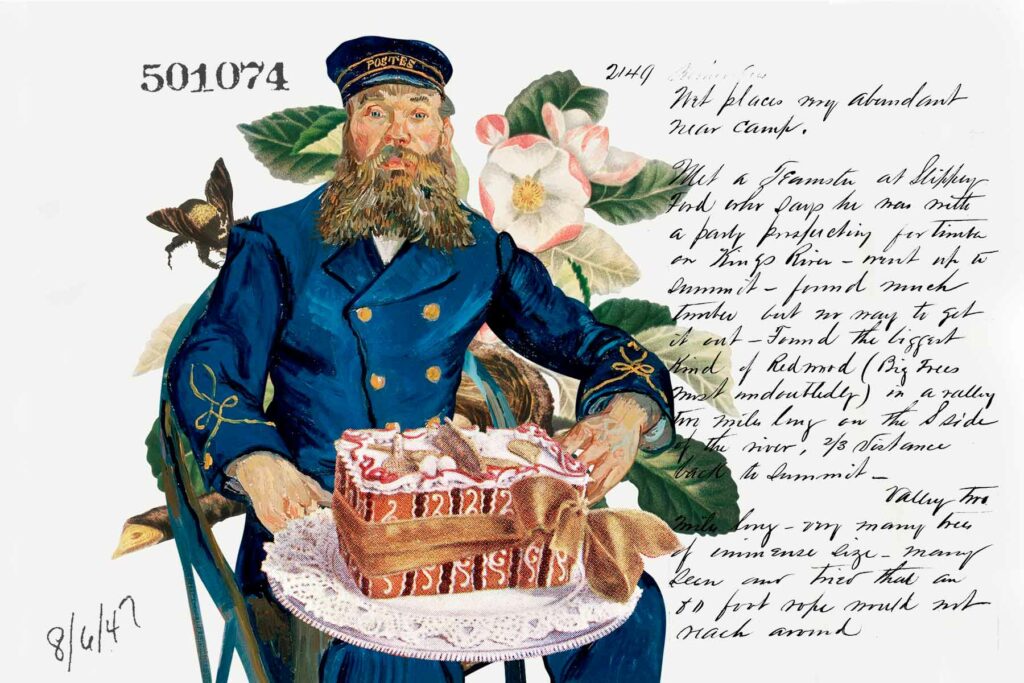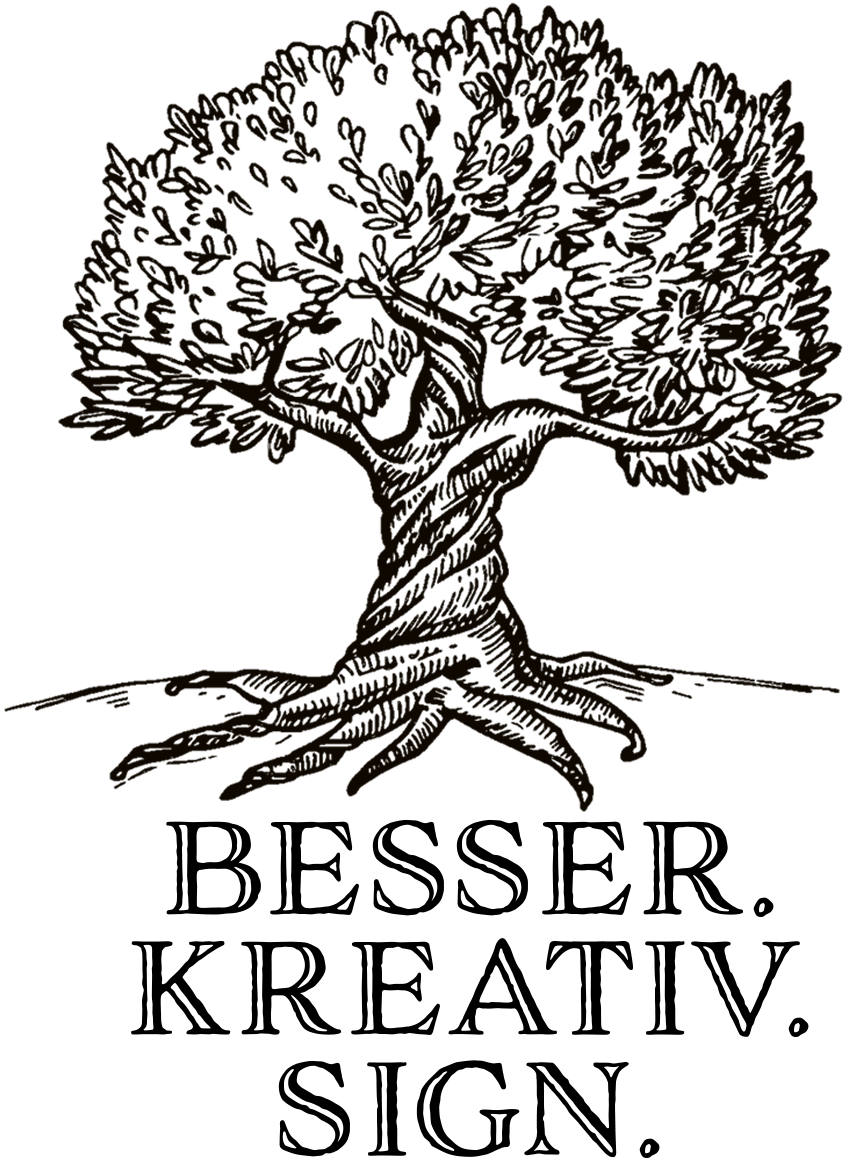Das Geheimnis der Kreativität
Kreativität gilt als Schlüsselfaktor in der menschlichen Entwicklung und Kultur. Denn nur so können wir Neues schaffen und innovative Lösungen finden, egal ob Musiker, Künstler oder genialer Erfinder und Wissenschaftler.
Aber wie entsteht Kreativität? Was passiert in unserem Gehirn? Und lässt er sich beeinflussen? Die Fähigkeit zu kreativem Denken ist tief in uns verwurzelt, auch wenn dies nicht bei allen gleichermaßen ausgeprägt ist. Das können Aha-Erlebnisse und kreative Geistesblitze genauso sein wie die Fähigkeit, komplexe Probleme effizient und richtig zu lösen.
Worauf diese Fähigkeit jedoch beruht und welche neurophysiologischen Prozesse dahinter stecken, versucht die Wissenschaft schon lange zu enträtseln.
AB WANN IST MAN EIGENTLICH KREATIV?
Suchen, finden und umbauen Jeder ist kreativ, aber die Fähigkeit und Motivation, kreativ zu sein, ist nicht bei allen gleich. Aber warum? Dazu müssen wir zunächst verstehen, wie kreatives Denken funktioniert und wo es in unserem Gehirn passiert.
Ideen zum semantischen Gedächtnis
Eine wichtige Grundlage für unsere Kreativität ist die Fähigkeit des Gehirns, gespeicherte Informationen abzurufen. Ausgangspunkt ist die Frage, die wir für kreatives Denken brauchen: „Ideen entstehen nicht aus dem Nichts: Es wird allgemein angenommen, dass sie durch das Suchen, Reorganisieren und Kombinieren von Informationen entstehen, die bereits in unserem semantischen Gedächtnis gespeichert sind.“ erklärt die Neurowissenschaftlerin Marcela Ovando-Tellez von der Universität Sorbonne in Paris. Daher ist klar, dass auch kreative Fähigkeiten eng mit diesen Prozessen verbunden sind. Wenn mein Gehirn beispielsweise besonders gut darin ist, viele zusammenhängende Informationen aus dem Gedächtnis abzurufen, kann es mir ein entsprechendes Set an Bausteinen und Ansätzen für eine kreative Lösung liefern. Tatsächlich bestätigten Untersuchungen von Ovando-Tellez und ihrem Team dies. Daher fördert es die Kreativität, denn unser Gehirn durchsucht seine Gedächtnisspeicher besonders flüssig und umfassend und erkennt weitreichende Zusammenhänge. Wenn das Gehirn beispielsweise bei der Suche nach dem semantischen Gedächtnis einen ausreichend engen Fokus hat, sind wir möglicherweise weniger kreativ und haben Mühe, großartige Lösungen zu finden. Ist der Fokus hingegen sehr breit gefächert, können wir auch auf vermeintlich ferne Ideen kommen und diese zu neuen Modellen kombinieren. Sortieren schafft Fokus Das allein reicht jedoch nicht aus: Das Gehirn muss auch aus dem Gedächtnis abgerufene Informationen erkennen können, die für die Lösung eines Problems unerlässlich sind, und unwichtige Daten aussortieren, sonst bleiben wir in unbedeutenden Details stecken. Daher muss es eine übergeordnete Steuerungsfunktion geben, die die aus dem Speicher abgerufenen Informationen in Bezug auf die Aufgabe klassifiziert. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass wir den vielversprechendsten Ansatz identifizieren und ihn umsetzen.